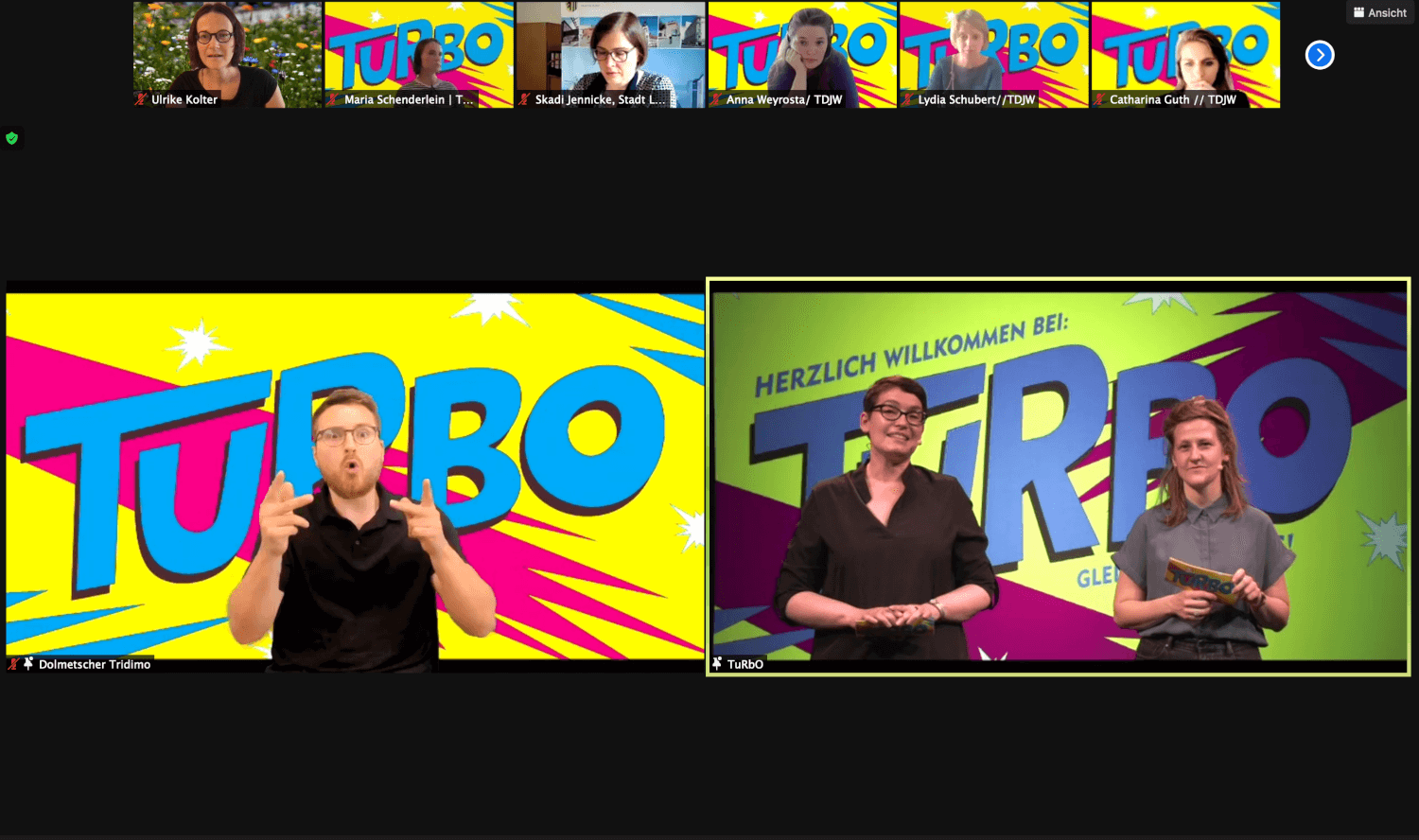URBÄNG-Festival in Köln widmet sich dem Krieg in der Ukraine
Foto: Screenshot aus „Chronicles of war, love and hatred“, einer Multimedia-Performance des media theatre Lwiw Text:Hans-Christoph Zimmermann, am 6. Oktober 2022
Krieg und Kultur sind kein Traumpaar, das sich auf den Dating-Plattformen der Weltpolitik sucht. Vermutlich ist kein größeres Missverhältnis denkbar, doch beide sind untrennbar miteinander verflochten, nutzen Strategien des anderen, werden vom anderen missbraucht – wie zuletzt Wladimir Putin in seiner Annexionsrede demonstrierte, als er den Krieg gegen die Ukraine in einen Kulturkampf gegen den Westen einbettete. Das von der Freihandelszone veranstaltete Festival der performativen Künste URBÄNG! in Köln widmete seine neueste Ausgabe diesen Fragestellungen: Wie kann Kultur, respektive Kunst, in Kriegszeiten weiterexistieren? Wie verändert sich die künstlerische Sprache durch den Krieg? Das Festival ergriff dabei Partei und lud ausschließlich ukrainische KünstlerInnen ein. Gleich das Auftaktgespräch offenbarte allerdings auch, wie weit (und vielleicht unüberbrückbar) die Distanz zwischen einem deutschen und dem ukrainischen Blick ist.
Serhij Zhadan trifft Navid Kermani
Auf der Bühne der Orangerie Köln diskutierten der ukrainische Autor und Musiker Serhij Zhadan, der am 23. Oktober den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen bekommt, und der Autor und Publizist Navid Kermani. Befragt nach seiner literarischen Produktion in Kriegszeiten zeichnete Serhij Zhadan, der in Charkiw zuhause ist, ein düsteres Bild. Er schreibe zwar täglich, denn: „Kultur darf nicht vor dem Krieg kapitulieren“. Doch der Blick auf frühere Werke hielten der Gegenwart nicht stand. „Wir müssen“, so Zhadan, „eine neue Sprache, neue Narrative suchen, um auszudrücken, was sich in der Ukraine abspielt“. Wie diese neue Sprache aussehen könnte, blieb etwas vage. Zhadan deutete an, dass er sich als Chronisten verstehe, der festhalte, was er sehe.

Diskussion mit Navid Kermani (l.) und Sehij Zerdan (2.v.r.) zur Eröffnung
des 22. URBÄNG!-Festivals in der Kölner Orangerie © Martin Rottenkolber
Serhij Zhadan hat sich bereits bisher in einem Gedichtband wie „Antenne“ oder dem Roman „Internat“ intensiv mit den Folgen des Krieges auseinandersetzt, mit dem Anspruch eines durchaus schmerzhaften Realismus. Und er ist ein poète engagée, der Hilfskonvois begleitete und mit seiner Band Hunde des Kosmos an die Front gefahren ist. Subkutan deutet sich im Gespräch deshalb auch die Idee an, dass Schreiben neben der Bestandsaufnahme auch Parteinahme bedeutet. Navid Kermani, der für sich in Anspruch nimmt, regelmäßig aus Kriegsgebieten zu berichten, plädierte dagegen für eine Literatur, die die Grautöne sucht und so dem klaren Freund-Feind-Denken des Kriegerischen etwas entgegensetzt. Schreiben habe die Aufgabe, „die Wirklichkeit von ihrer Eindeutigkeit“ zu befreien. Waren sich die beiden Autoren immerhin in der Ablehnung des Gefasels von der „Zeitenwende“ oder dem pazifistischen Geraune westlicher Intellektueller einig, so kam es in der Bewertung russischer Künstler und Künstlerinnen schließlich zum Konflikt. Nach Butscha und Mariupol verfüge er über keinerlei Empathie mehr für russische Künstler, sagte Serhij Zhadan. Sie hätten seit 2014 beharrlich geschwiegen. Navid Kermanis Einwand, dass die Motive für Flucht und Schweigen jedes/r Einzelnen doch individuell sein mögen und man sich von Verallgemeinerungen hüten müsse, ließ Serhij Zhadan nicht gelten. Auch die Idee, dass Künstler vielleicht die Agenten einer zukünftigen Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine sein könnten, überzeugte ihn nicht.
Serhij Zhadans klare kompromisslose Haltung kam dann im Konzert, das den Abend beschloss, so richtig zum Tragen. Die Songs seiner Punk-Ska-Band oszillieren, ähnlich wie seine Gedichte, zwischen drastischer Beschreibung und schrägem Hymnus. Sie kreisen um Drogenprobleme; eine Straßenbahnfahrt führt einen ehemals erfolgreichen Unternehmer direkt in den Hades; religiöse Bilder und Metaphern verweisen auf Zweifel an den Verlautbarungen der orthodoxen Kirche; doch letztlich überwiegt, vermittelt auch durch das Energetische der gitarrenlastigen Musik, die Metapher des Kampfes. Oder wie es im Song „Wo ist deine Linie?“ heißt: Jeder muss für sich seine „Mannerheim-Linie“ definieren – womit die Verteidigungslinie des finnischen Generals Mannerheim im russisch-finnischen Krieg von 1939/40 gemeint ist.
media theatre Lwiw: „Chronicles of war, love and hatred“
Im Zentrum der Festival-Eröffnung stand die Multimedia-Performance „Chronicles of war, love and hatred“, eine Produktion des media theatre Lwiw um Sashko Brama, Maria Yasinka und Liuda Batalova zusammen mit dem post:theater berlin. Die Chroniken illustrierten quasi in actu die Auftaktdiskussion um die ästhetische Reaktion auf einen Krieg.

Szene aus „Chronicles of war, love and hatred“ © Martin Rottenkolber
Vor einer Leinwand sitzen die drei SchauspielerInnen Anna Möbus, Anja Jazeschann und Marius Bechen und geben den drei ukrainischen MacherInnen ihre Stimme. Bilder einer unberührten vernebelten Flusslandschaft werden in einem Prolog mit Sashkos Kindheits-Erinnerung an seine Großmutter unterlegt. In den folgenden sieben Kapiteln spiegelt sich die Entwicklung des Krieges dann im Produktionsprozess der Chroniken. Bewegende Abschiedsszenen zwischen Familien und ihren zurückbleibenden Vätern am Bahnhof in Kiew werden mit dem Entschluss des ukrainischen Trios, Reportagen zu erstellen, kurzgeschlossen. Maria, die einen Sohn hat und mit Sashko liiert ist, beschließt nach Polen zu fliehen, bleibt aber dann doch in Lwiw. Liuda sammelt Material für Reportagen und die Theater-Performance. Und Sashko dreht in einem Krankenhaus in Kyiv, filmt OPs und Verwundete, folgt einem Arzt. Was diese Personen wirklich erlebt haben, erfährt man kaum. Hier zeigt sich bereits ein Problem, das sich durch den ganzen Abend zieht: einer eher rhapsodischen Gesamt-Dramaturgie, einer additiven Bildreihung und eines nicht immer durchgehaltenen Interesses für die gefilmten Personen. Da sieht man Bilder der zerbombten Vorstädte Kyivs, erfährt von Liudas Vergewaltigung bei einem Job in Bayern, hört vom ukrainischen Geheimdienst mitgeschnittene Telefonate von russischen Soldaten, die sich bei ihren Muttern die Erlaubnis abholen ukrainische Frauen zu vergewaltigen. Man kann das als allgegenwärtigen Gewaltzusammenhang deuten, bleibt aber doch etwas unschlüssig zurück. Bewegend wird es immer dann, wenn es zu einer teilnehmenden Beobachtung kommt: So bei einem Pastor, der demonstriert, wie er mit den russischen Soldaten sprach und trotzdem von ihnen gefoltert wurde. Er zeigt dem Team die Leiche eines Mannes, den Sashko filmt und dabei über seinen ästhetisierenden Blick erschrickt. Ernst Jüngers berühmte Burgunder-Sentenz ist da nicht weit. Oder wenn Ira von ihrer Schuld erzählt, weil sie wegen ihrer Hunde und Katzen ihren Mann zum Bleiben überredet hat, und er erschossen wurde. Sie legt ihm schließlich eine brennende Zigarette aufs Grab. Sashko und Maria, die Reportage-Aufträge polnischer Medien angenommen haben, streiten quasi parallel zu diesen Szenen immer heftiger über das Mischverhältnis von Dokumentation und Kunst. Ein durchaus bekanntes Problem.
Es mag überheblich erscheinen, aus einer westlichen sicheren Position über Kunst aus einem Kriegsgebiet zu urteilen. Doch so ganz glücklich wurde man mit diesen Chroniken nicht, wobei der Mangel an Dramaturgie seinen Grund auch in der schieren Überwältigung durch ein Übermaß an Realität haben kann. Vielleicht zeigen die Chroniken letztlich aber genau das Ringen darum, wie in Kriegszeiten überhaupt noch ästhetisch gesprochen werden kann.
Die 22. Ausgabe des URBÄNG!-Festivals läuft noch bis zum 8. Oktober. Zum Festival-Programm geht es HIER

Trotz alledem: Stimmungsvolles Beisammensein nach dem Festival-Auftakt
© Martin Rottenkolber