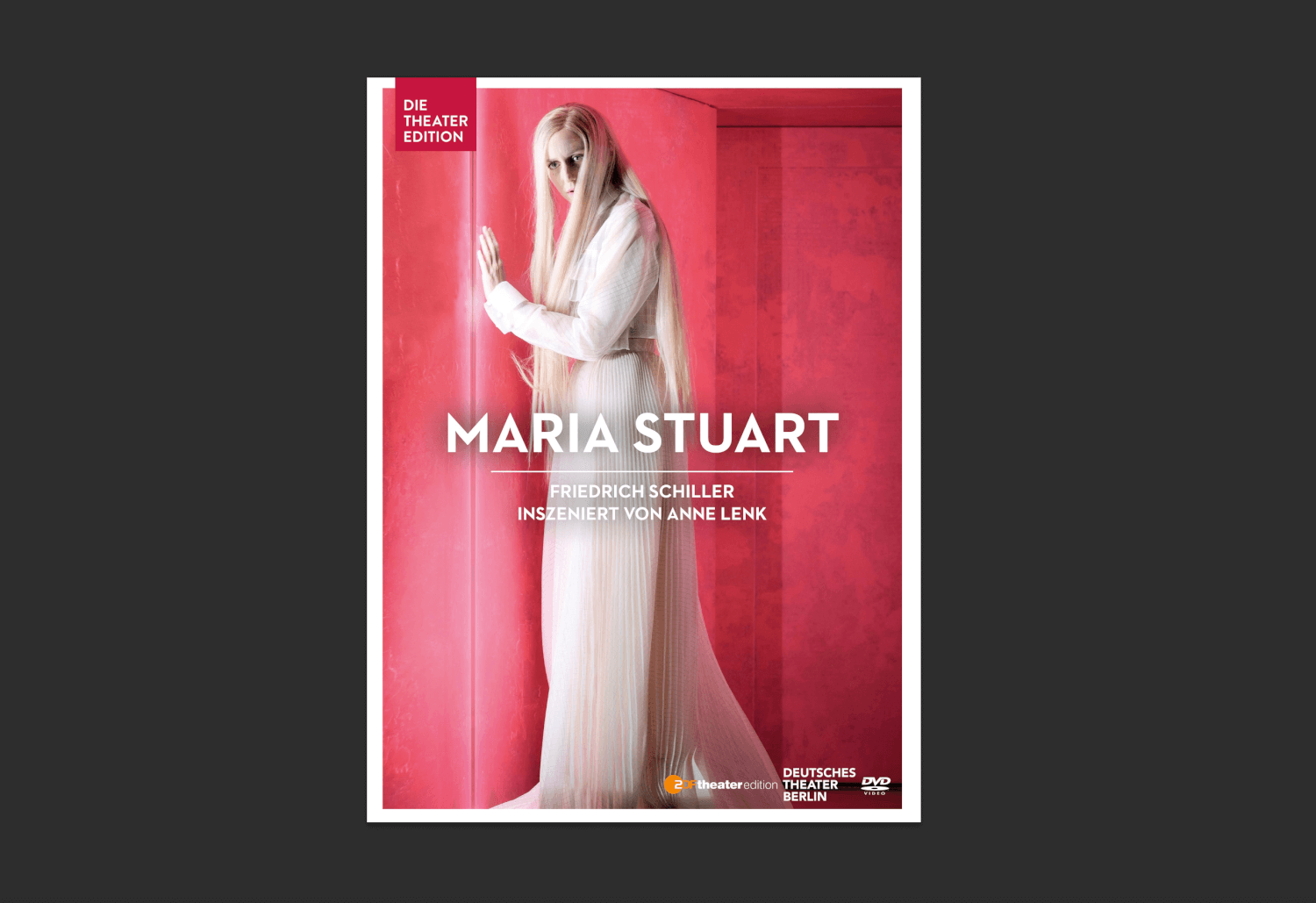Buch: Spielplatz 36. Fünf Nonsens-Stücke für Kinder.
Text:Manfred Jahnke, am 4. April 2023
Alice oder der Hase in der Vase
Es gibt nicht viele Verlage, die es wagen, Kindertheaterstücke in Buchform zu drucken. Zwar wäre das potentielle Publikum groß: Theatermenschen, Eltern, Großeltern, Lehrer:innen, Erzieher:innen, Kritiker:innen, aber die Wahrheit ist: wer will sich schon für einen Theaterbesuch mit Kindern vorbereiten, wer ein Kindertheaterstück im Unterricht analysieren? Kurz: die Printveröffentlichung von Theatertexten für ein junges Publikum stößt auf Schwierigkeiten, umso erfreulicher, dass der Verlag der Autoren nicht aufgibt, jährlich den „Spielplatz“ mit einer Sammlung von fünf bis sechs Stücken unter einem speziellen Thema zu veröffentlichten. Gerade ist die 36. Ausgabe erschienen mit dem Schwerpunkt: „Fünf Nonsens-Stücke für Kinder“. In seinem Nachwort weist der Herausgeber Thomas Maagh darauf hin, dass Nonsens-Literatur in Umbruchzeiten Konjunktur habe. Mit der Unsicherheit, wie mit neuen Herausforderungen umzugehen ist, wächst die Lust am sinnwidrigen Sprachspiel, an Tautologien, an den Paradoxien des Un-Sinns, zumeist in kurzer kompakter Form, rhythmisch gegliedert. Auf die Bühne übertragen, blitzen diese in clownesken Formen auf, wobei auffällig ist, dass vier der fünf Stücke, die Maagh für seinen Band ausgewählt hat, nicht nur auf Sprach- und Sprechspielen basieren, sondern die Theatersituation selbst thematisieren.
In „Der Hase in der Vase“ (UA 2022) lässt Marc Becker beispielsweise einen Feuerwehrmann auftreten, der gleich zu Beginn ankündigt, dass die heutige Vorstellung „möglicherweise ausfallen muss“. Mit kleinen Slap-Sticks, wie dass sich seine Thermosflasche nicht öffnen lässt oder das Telefon aufhört zu klingeln, wenn er endlich am Apparat ist, versucht er, sich die Zeit zu vertreiben. Nach und nach kommen ein Mann und eine Frau hinzu, die aber nichts mit dem Theater zu tun haben, was zu Missverständnissen, Theatertricks – ein Sturm bläst aus einer Tasche – und einem sinn-freien Dialog führt, bis am Ende die Ohren des Hasen in einer stinkenden Vase sichtbar werden. Becker merkt einleitend in seinem Text zur „Bühne“ kurz „Ja“ an. Als besondere Anmerkung notiert der Autor: „Die Vorstellung ist eine Vorstellung.“ Mit der Behauptung eines möglichen Vorstellungsausfalls bleibt er zunächst in einem dramaturgisch konventionellen Rahmen, der sich in einer sich steigernden Absurdität (warum nur an Ionesco denken?) überschlägt: Nonsens und absurdes Theater haben gemeinsam, einer sich logisch gerierenden Welt alogische Strukturen entgegen zu setzen und die (scheinbare) Sinnhaftigkeit der gegenwärtigen Welt zu destruieren.
Insofern gehen auf der Bühne Nonsens, Clownerie und die Philosophie des Absurden nicht nur eine enge Verbindung ein, sondern provozieren in dieser Gemeinsamkeit auch mit ihrer Lust am Un-Sinn paradoxerweise Sinn. Dessen Abwesenheit bezeugt zugleich seine Anwesenheit, die damit Bezugspunkt aller Spielereien bleibt. Das ist auch deutlich dem Text von Juliane Blech abzulesen, der sich hauptsächlich mit Wortspielereien und Tautologien beschäftigt. Schon der Titel „Farilari“ (UA 2013) verdeutlicht diese Freude an Laut- oder Buchstabenverdrehungen, erinnert doch „Farilari“ an eine berühmte Figur von Pocci, den Kasperl Larifari. Auch hier agieren Murks, Flatsch, der kriechende und deshalb stinkende Sellerie und aus dem Off: Quatsch mit clownesken Bewegungen. In den Begegnungen mit schmerzhaften Objekten, wie im Spiel mit der Sprache, die immer lautmalerischer wird, entsteht eine surreale Welt, die an die Lust von Kindern anknüpft, schöpferisch sich einen eigenen Sprechraum zu schaffen. Nicht zufällig steht da plötzlich ein (sich vorzustellender) Elefant, auf dem das Ensemble am Ende langsam reitend den Raum verlässt, mit der Frage: „Aber es geht doch immer weiter?“
Am konsequentesten geht Carsten Brandau in „Schiefer gehen“ (UA 2018) bei den Sprechspielen vor, weil er sich dabei eng an die Theorie der Sprechakte von John R. Searle und der Sprachphilosophie eines Ludwig Wittgensteins hält: Brandau lässt seine zwei „Königskinder“, die ständig die Rollennamen wechseln – Drauf und Dran, Hier und Jetzt, Rotz und Wasser, etc. –, im Sprechen die Sprache destruieren, bis am Ende nur noch aus dem Gestammel einzelne Begriffe auftauchen. Dennoch hört die Kommunikation zwischen den beiden nicht auf. Das Theaterpublikum wird dabei nicht nur in den philosophischen Reflexionen, die Brandau in seinen Text einstreut, thematisch, sondern als eine anwesende Größe behandelt und direkt angespielt. Mit dem Publikum wird das Theater selbst zum Sujet: Zu Beginn ist der Raum dunkel und Jetzt findet in der Finsternis nicht den Scheinwerferpult, stattdessen lässt er es regnen oder blitzen, gar die ganze Bühne beben, bis endlich der richtige Lichtschalter gefunden ist. In kreiselnden Dialogen ohne Handlungsziel steht das „Schiefer gehen“ als Metapher des Entrückt-Seins (oder -Werdens?) im Zentrum. Denn, wie es in einer der Reflexionen heißt: „Und deshalb darf Theater, das vom Schiefgehen handelt, nicht nur selbst SCHIEF gehen – es muss vielmehr SCHIEFER als schief gehen.“ Brandau macht das auf wunderbar philosophisch-poetische Art.
Einen „Klassiker“ enthält der „Spielplatz 36“ mit „Zirkus Šardam“ von Daniil Charms (1905 – 1942), ein Marionettentheater-Stück (DE 2002). Die Texte des Autors, der 1942 auf dem Höhepunkt der stalinistischen Verfolgungen hingerichtet wurde, waren verschwunden und wurden erst nach 1989 nach und nach veröffentlicht. In „Zirkus Šardam“ stört in einer laufenden Zirkusvorstellung Vertunov, der unbedingt als Artist angestellt werden möchte. Klafft schon zwischen seiner Forderung und seinen akrobatischen Fähigkeiten eine absurde Distanz, so kippt das Spiel in seinem Verlauf ins absolute, surreale Chaos. Im zweiten Teil, in dem ein zertrümmertes Aquarium den ganzen Zirkus unter Wasser setzt, mit bedrohlichem schwimmendem Haifisch, findet die Absurdität ihren Höhepunkt. Und für Vertunov gibt es noch ein Happy-end: er entsteigt dem Hai und er erhält das ersehnte Engagement als „Clown, Kämpfer, Sänger und Tänzer in einem“ – vorerst allerdings nur als Assistent.
Im Gegensatz zu den drei zuvor besprochenen Stücken entwickelt Charms eine durchgängige Handlung. Der Schwerpunkt des Nonsens liegt nicht auf den Sprachspielen und Wortverdrehungen, sondern in einer situativen Komik, die sich in einem immer höheren Tempo überschlägt. Auf dem Höhepunkt wird dann das scheinbar Unmögliche wahr und zeigt sich die subversive Kraft des Nonsens. Und natürlich darf in einer solchen Anthologie auch nicht der Klassiker des Nonsens schlichthin fehlen: „Alice im Wunderland“ von Lewis Carrol, hier als „Alice“ in der Fassung von Katja Hensel (UA 2008). In dieser Bearbeitung spielen vier Frauen, die zunächst einen nicht sichtbaren Elefanten bewachen. Schon in diesem Vorspiel entfalten sich Logik und Unlogik zugleich, weil aus Angst vor einem Nicht-Bären der Nicht-Elefant im Stich gelassen wird. Aber das muss nicht ausdiskutiert werden, schon verwandelt sich eine der Spielerinnen in Alice, eine andere in das Kaninchen mit der Armbanduhr. Die Handlung folgt nun weitgehend den Stationen des Romans, mit einem entscheidenden Unterschied: die Geschichte wird nicht als Traum von Alice erzählt, sondern sie ereignet sich im Augenblick. Das gibt dieser Fassung eine Schärfe, aber auch eine Komik, wie nur wenige Fassungen, die ich kenne: Mit ihrer entwaffnenden Naivität, die die Ereignisse, die ihr begegnen, einfach hinnimmt, wird „Alice“ zu einer paradoxen Einführung in die Identitätsphilosophie.
Es ist zu hoffen, dass die Texte ein breites Publikum finden, vielleicht auch in mancher Dramaturgie?
Thomas Maagh (Hg.): Spielplatz 36. Fünf Nonsens-Stücke für Kinder. Verlag der Autoren, 2023. 220 Seiten. 22 Euro.