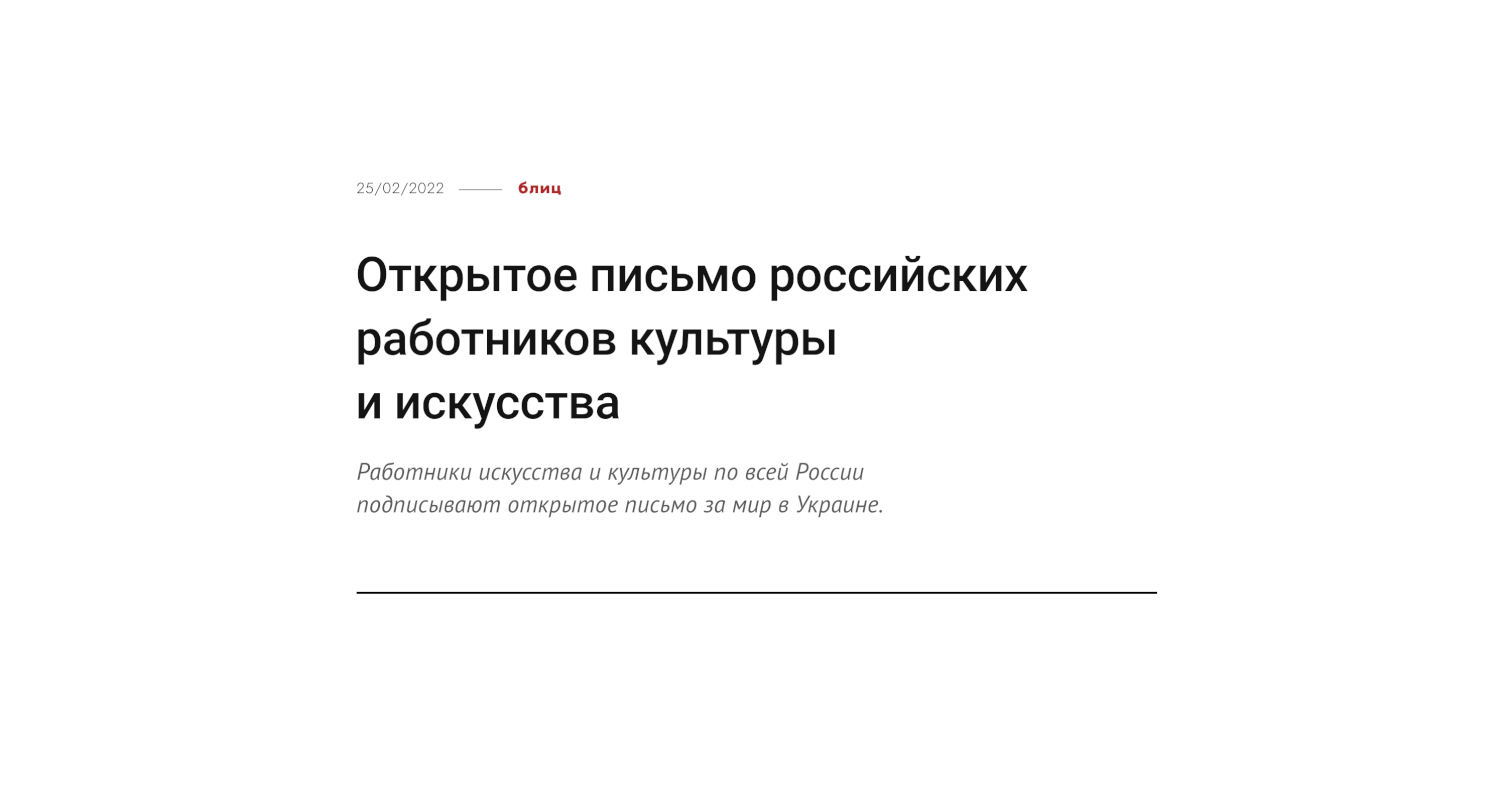Theater für alle?
Foto: „1989“ in der Inszenierung von Katarzyna Szyngiera im Teatr im. Słowackiego in Krakau (Koproduktion mit dem Teatr Szekspirowski in Danzig) © Bartek Barczyk Text:Iwona Nowacka, am 26. November 2025
In unserer Serie „Andere Theatersysteme“ blicken wir ins Nachbarland Polen. Die Theatermacherin und Übersetzerin Iwona Nowacka zeigt in ihrem Überblick deutliche Parallelen zu Deutschland auf und kennzeichnet die Unterschiede beider Systeme.
Das polnische Theaterökosystem unterscheidet sich von dem deutschen nicht gravierend. Die Theaterkunst wird in Polen zum großen Teil öffentlich getragen. Im Jahr 2015 wurde die Idee des teatr publiczny, das im Polnischen direkt von „publicus“, also „allen gehörend“ oder „mit dem Volk verbunden“ abgeleitet wird, 250 Jahre alt. Dieses Jubiläum der ersten Inszenierung des von König Stanisław August Poniatowski gegründeten Ensembles, das dann zum ersten öffentlichen polnischen Theater, Teatr Narodowy in Warschau, wurde, fiel ausgerechnet in das Jahr der Machtübernahme durch die rechtskonservative Partei PiS, die fleißig an der Re- oder eher Dekonstruierung der Theaterlandschaft arbeitete. Die acht folgenden Jahre machten auf eine brutale Weise die Fragilität dieser Idee sichtbar.
Entwicklung nach Krieg und Wende
Die Gestalt der heutigen Theaterstrukturen Polens wurde infolge der unter sowjetischem Einfluss durchgeführten Verstaatlichung nach dem Zweiten Weltkrieg geformt. Nach der Wende zu Beginn der 1990er-Jahre wurde eine an das neue System angepasste Rechtsform der Kulturinstitution erschaffen und ein Prozess der Dezentralisierung angestoßen, sodass die Theater zum großen Teil nun den lokalen Regierungen unterliegen. Im Jahre 2024 gab es nach Angaben des polnischen Statistischen Hauptamts 206 Theater und Musikinstitutionen. Fast 85 Prozent davon sind öffentliche Institutionen, und 93 Prozent unterliegen Kommunen oder Städten.
Es gibt drei staatliche Bühnen, die direkt dem Ministerium unterliegen: das schon erwähnte Teatr Narodowy in Warschau, das Teatr Wielki – Opera Narodowa in Warschau und das Narodowy Stary Teatr in Krakau. Die Theaterhäuser bekommen staatliche Unterstützung, die nach Angaben des Ministeriums 65 Prozent des jährlichen Theaterhaushalts ausmacht. Den Rest der Mittel muss das Theater hauptsächlich aus Kartenverkauf und Förderprogrammen selbst erwirtschaften.

Das Teatr Narodowy in Warschau. Foto: Marta Ankiersztejn/Künstlerisches Archiv des Teatr Narodowy.
Die meisten der öffentlich getragenen Häuser des Landes haben ein festes Ensemble, das aus professionell ausgebildeten Darsteller:innen besteht, die auch fest angestellt sind, wobei ihnen ein festes monatliches Grundgehalt und ein Honorar pro Vorstellung zustehen. Die Produktionen bleiben fünf bis sechs Spielzeiten oder je nach Erfolg länger im Spielplan. Gespielt wird immer in Sets von zwei bis fünf Vorstellungen, was den Auf- und Abbauaufwand reduziert.
Die nicht öffentlichen Theater gliedern sich in private, eher gewinnorientierte Theater mit Unterhaltungsprogramm sowie NGOs (Stiftungen, Vereine), die zum großen Teil die freie Szene ausmachen. Ihre Situation ist deutlich schwieriger als die in Deutschland. Die Förderungsmöglichkeiten sind wesentlich kleiner und eher projektbezogen. Wobei bei den größten Programmen (wie zum Beispiel Ministeriumfördermittel) sich sowohl öffentliche Institutionen als auch die freie Szene bewerben, was zu einer ungleichen Konkurrenz um Ressourcen führt. In den Fällen, wo ein freies Haus eine mehrjährige Subvention bekommt, deckt diese oft nur die Fixkosten. Außerdem arbeiten viele Künstler:innen in informellen Gruppen ohne Rechtspersönlichkeit, weil eine solche mit finanziellen Unkosten verbunden wäre. Somit sind sie aus zahlreichen Förderungen ausgeschlossen.
Einspartenhäuser
Im für seine Theaterlandschaft bekannten Deutschland gibt es rund 150 öffentlich geführte Theaterunternehmen. Polen ist flächenmäßig kleiner und weist eine geringere Theaterdichte auf. Daher kann die oben erwähnte hohe Anzahl von über 200 Institutionen dieser Art zunächst verwundern.
Dies dürfte auch an der Abwesenheit der Institution Mehrspartenhaus in Polen liegen. Zwar gibt es Verbindungen im Spielprogramm oder im Rahmen einzelner Produktionen – was in den zunehmend durch Interdisziplinarität gekennzeichneten darstellenden Künsten nicht wundert –, aber im Kern sind die Theater des Landes an eine Sparte gebunden. Die meisten der öffentlich geführten Häuser sind Schauspieltheater. Außerdem gibt es Opernhäuser, Musiktheater, Operetten, ein Pantomimentheater in Wrocław sowie Puppentheater, die in Polen jahrelang der größte Anbieter des Angebots für junges Publikum waren. Dann entdeckten auch die Schauspielhäuser das junge Publikum für sich und produzieren immer mehr Kinder- und Jugendinszenierungen.
Nachholbedarf im Tanz, Jungen Theater, auf dem Land
Dieses Jahr ist das erste polnische Jugendtheater entstanden. Das Warschauer Teatr Ochoty nimmt ein solches Profil an, nachdem die neue Intendanz mit diesem Konzept den Wettbewerb um die Theaterleitung gewonnen hat. Auch das Tanztheater, das als eine sich sehr dynamisch entwickelnde Sparte seit Jahren in dieser Hinsicht zu kurz kommt, bekommt nach Jahren heißer Debatten demnächst auch endlich eine eigene Spielstätte (Pawilon Ta´nca i Innych Sztuk Performatywnych) in Warschau.
Landesbühnen mit ihrem Konzept des tourenden Spielplans sind in Polen gänzlich unbekannt. Teilweise erfüllen die anderen Häuser aus zusätzlichen Förderungsprogrammen (wie zum Beispiel dem Ministeriumprogramm Teatr Polska, das seit 2009 Gastspiele in Orten ohne Theaterinstitutionen ermöglicht) die Aufgaben einer Landesbühne. Die Entscheidung dafür oder dagegen liegt jedoch völlig bei der jeweiligen Theaterleitung. Ein Angebot für ländliche und kleinstädtische Gebiete ist nicht explizit mit im Programm vorgesehen. Viele Menschen in Polen bekommen deswegen gar keinen Zugang zu dem theoretisch „allen gehörenden“ Kulturgut Theater.
Wettbewerbe und Transparenz bei Leitungswechseln
Theaterleitungen werden für eine gewisse Amtszeit in einem offenen Wettbewerb gewählt. Da die Behörden jedoch die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit haben, Verträge ohne Wettbewerbsverfahren zu verlängern, gab es in den letzten Jahrzehnten viele Fälle von endlos dauenden Theaterleitungen. Dies zu ändern, hat sich das neue Kulturministerium nach dem Regierungswechsel 2023 zum wichtigen Ziel gesetzt.
Nun sollen überall, wo eine vertraglich vereinbarte Intendanz zu Ende geht, Wettbewerbe ausgeschrieben werden. Beispielsweise im Fall von Jan Englert, der 22 Jahre auf dem Intendanzposten des Teatr Narodowy in Warschau verbrachte. Deswegen war es in der Szene nicht sehr positiv wahrgenommen worden, dass der neue Intendant des Teatr Nowy in Warschau, Michał Merczy´nski, einfach ernannt wurde, weil für das Theater von Krzysztof Warlikowski und sein Ensemble eine Ausnahme gemacht wurde.
Die Informationen über die Ausschreibung und Kriterien eines Intendanzwettbewerbs sind öffentlich. Das gilt auch für die Kandidat:innennamen und Ergebnisse der Abstimmung der Auswahlkommission. Immer häufiger veröffentlichen die Kandidat:innen selbst ihre Programme, auch wenn es in manchen Fällen erst nach dem Auswahlverfahren geschieht. Leider werden die Wettbewerbe meistens jedoch viel zu kurzfristig ausgeschrieben – oft erst ein paar Monate vor dem Intendanzantritt. Das lässt nicht viel Zeit für Vorbereitungen und die Einführung in die neuen Pflichten. Manche Theaterleute versuchen selbst etwas dagegen zu unternehmen. So hat zum Beispiel an dem schon genannten Teatr Ochoty die scheidende Intendantin Joanna Nawrocka die Stadt Warschau persönlich dazu aufgerufen, den Wettbewerb für ihren Posten früh genug auszuschreiben, was zur Folge hatte, dass die neue Intendanz fast ein Jahr vor dem Antritt bekannt war.
Vorbildliches TV-Theater
Die polnische Theaterlandschaft wird last but absolutely not least durch die größte Bühne der Welt ergänzt: das Teatr Telewizji (Fernsehtheater), das seit dem Anfang der polnischen Fernsehgeschichte existiert. Intendant Michał Kotan´ski, der das Theater 2024 übernommen hatte, stellte im schwindelerregenden Tempo dessen früheren Glanz wieder her und machte die beeindruckend erfrischte Fernsehbühne mit einem für viele Theatersprachen offenen Programm zum Theater des Jahres, zumindest gemäß einem Fünftel der Kritiker:innenumfrage der Zeitschrift Teatr.
Das Fernsehtheater produziert eigene Inszenierungen und Verfilmungen von wichtigen Produktionen, die schon auf den Bühnen des Landes zu sehen sind. Gezeigt werden sie montags, wenn die Theater vorstellungsfrei haben, sie sind aber auch im Streaming jederzeit abrufbar. Im Schnitt schauen sich eine Vorstellung 340000 Zuschauer:innen an, bei Hits wie der Übertragung des Musicals „1989“ – einer von dem New Yorker „Hamilton“ inspirierten gerappten Solidarność-Geschichte aus dem Teatr im. Słowackiego in Krakau – saßen mehr als 800000 Menschen vor dem Fernseher. Wenn man von der Mission des teatr publiczny, des öffentlich getragenen Theaters, und dem Ziel einer Zugänglichkeit für alle spricht, dann kann man bei dem Fernsehtheater tatsächlich konstatierten, dass hier derzeit Vorbildliches gelingt.
Dieser Artikel ist erschienen in Heft Nr.6/2025.